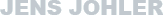Über den autoritären Geist des deutschen Theaters
Erschienen in Theater Heute 4/68, S. 2-4
Redaktioneller Vortext:
Wie soll ein Theater verfasst sein? Heinz Hilpert, ein Freund seiner Schauspieler plädierte doch für die „aufgeklärte Despotie“ des Theaterleiters. Das heutige Vertragsrecht gibt dem Intendanten allein entscheidende Rechte: er bestimmt über Spielplan und Engagements. Was die einzelne Inszenierung anlangt, so liegt alle Macht beim Regisseur. Nicht alle Schauspieler halten diesen Zustand für den einzig richtigen. Im vorigen Heft berichteten wir über die markigen Äußerungen von Ekkehard Schall, dem Star des Berliner Ensembles. Er will den Regisseur nur als Diskussionspartner, als dramaturgischen Berater.
Was ist ein demokratisches Theater? Diese Frage wirft der nachstehende Diskussionsbeitrag zweier Schauspieler auf. Es ist darin die gleiche Unruhe spürbar wie in den Reform- (oder Revolutions?-) Vorschlägen der Studenten. Ist Demokratie im Theater praktizierbar, oder ist nur ein Theater für die Demokratie denkbar? Findet die Demokratie im Theater ihre Grenze an dem Kunstanspruch, den nur einer verantworten und nur einer durchsetzen kann?
Ist die Krise des deutschen Theaters eine Führungskrise? Brauchen wir bessere Intendanten? Oder liegen die Gründe tiefer, ist die Krise am Ende ein Ergebnis des Systems? Der folgende Versuch, diese Fragen zu beantworten, geht vom Schauspieler aus.
Der Schauspieler formuliert das Ergebnis eines Arbeitsprozesses, seine Aktionen auf der Bühne sind bestimmt durch die Funktion der Rolle innerhalb des Stücks, die Konzeption des Regisseurs, die diese Funktion auf eine bestimmte Weise interpretiert, und durch die eigene Natur, die sich in eine von der Bühnenfigur definierte Richtung hin öffnet. So gesehen, bietet der zentrale Standort des Schauspielers innerhalb der Theaterarbeit eine gute Voraussetzung, grundsätzliche Mängel der Arbeitsmethoden am Theater und deren Ursachen aufzuzeigen.
Wollten wir der Sache auf den Grund gehen, das Ausmaß der Misere abstecken, müssten wir mit einer Kritik der Gesellschafsstruktur der BRD beginnen Um das Problem als ein innerbetriebliches in überschaubare Dimensionen zurückzuholen, sei aus Hellmuth Karaseks Stellungnahme für Palitzsch (Theater heute Dok.2/68) folgende Passage zitiert und als Idealbasis für ein „funktionsfähiges“ westdeutsches Theater vorausgesetzt: „Sollen Subventionen sinnvoll verwendet werden und nicht dazu, aus dem Theater eine selbstgefällige Dekoration zu machen, ... dann kann der Geldgeber seine Aufgabe nur so sinnvoll verstehen, .... dass er für die Gesellschaft ein kritisches Forum duldet und sogar subventioniert, das ihr und dem Subventionsträger so den Spiegel vorhält, als wäre es unabhängig.
Die These von der Führungskrise
Der Ruf nach potenten Theaterleitern wird immer wieder lauf: der Bürokrat soll vom engagierten Temperament, der Manager vom künstlerischen Initiator ersetzt werden. Gody Suter schlägt in einem Artikel in der „Weltwoche“ (Theater heute Dok.2/68) vor, dem Theaterbetrieb als Direktor den Literaten voranzustellen. Dieser und ähnliche Vorschläge zur Wiederbelebung des deutschen Theaters zielen jedoch am Problem vorbei. Gody Suter schreibt: „Es gehört zum Wesen der Vergnügungsindustrie, .... dass sie marktgerechte Halbfabrikate zu Fertigprodukten verarbeitet, mit dem bestmöglichen „Finish“, mit einer möglichst perfekten Oberfläche: das Endprodukt darf keine Spur vom Arbeitsprozess erkennen lassen. ... So findet kein Dialog statt, das Theater spricht weder mit dem Autor noch mit dem Publikum, es kauft ab, setzt vor und nirgends – außer bei den Theaterleuten und bei den Zuschüssen – ist eine Spur von prinzipieller Zusammenarbeit auszumachen.“
Mit diesem Satz: „Das Endprodukt darf keine Spur vom Arbeitsprozess erkennen lassen“, kommt Suter auf etwas Wesentliches; aber er zieht daraus keinen Schluss. Er betrachtet das Theater als ein komplexes Ganzes, von außen und meint, es werde genesen, wenn es einen besseren Führer hätte. Ihm gibt zu denken, dass das Theater nicht engeren Kontakt zum Dramatiker suche; er möchte den Dramatiker am Theater selbst wirken sehen, er meint, der Hersteller von Dialogen könne auch den Dialog zwischen Theater um Umwelt wieder in Gang bringen.
Gegenthese von der Krise als Folge des Systems
In Wahrheit sieht die Sache anders aus. Dass es das Theater versäumt, sich nach außen hin wirksam zu artikulieren, liegt nicht daran, dass der Mann an der Spitze den Leuten außerhalb des Theaters nichts zu sagen hat, sondern daran, das die Leute innerhalb des Theaters nichts zu sagen haben. Wie kann das Theater Diskussionspartner der Gesellschaft sein, wenn die Diskussion innerhalb jener Gesellschaft, die das Theater selbst ist, nicht stattfindet? Auch ein genialer Intendant kann nicht ersetzen, was das Theater braucht, um lebendige, interessante Produkte hervorzubringen: den Dialog der am Arbeitsprozess Beteiligten, d.h. die fruchtbare Auseinandersetzung der künstlerischen Mitglieder untereinander. Der Theaterbesucher muss mangelnde Transparenz und langweilige Perfektion der Inszenierungen ertragen weil ein echter Arbeitsprozess gar nicht stattgefunden hat, und weil durch Perfektion („bestmögliches finish, möglichst perfekte Oberfläche“) ersetzt wird, was unter gemeinsamer Verantwortung an lebendigem Einsatz geleistet werden müsste. Das gegenwärtige System aber enthebt den einzelnen der Verantwortung für das Ganze.
Die innerbetriebliche Struktur des subventionierten westdeutschen Theaters zeigt einen hierarchischen Aufbau. Im Normalvertrag zwischen dem Deutschen Bühnenverein und der G.D.B.A. wird der Intendant als Unternehmer bezeichnet: Ein Unternehmer ohne Risiko aber ist in der freien Marktwirtschaft nicht denkbar. Denkbar und vorhanden dagegen ist die Tatsache, dass ein Intendant mit festen Bezügen sehr wohl die Machtbefugnisse eines Unternehmers hat, dass ein Kollektiv von sog. Schöpferischen Mensch nicht sich selbst regiert sondern einer Obrigkeit gehorcht, die Machtbefugnisse nach unten verteilt und dem Schauspieler schließlich (von dem aus die Situation am Theater hier ja gesehen und erläutert werden soll) kein anderes Recht lässt als das, den Anweisungen eines Regisseurs folgen zu dürfen. Das Theater wird undemokratisch regiert, es hat sich ein feudalistisches Wesen bewahrt, das den meisten Schauspielern bewusst ist und genüsslich von ihnen akzeptiert wird. Sie wollen es gar nicht ändern, sie nehmen in masochistischer Weise die Notwendigkeit zu buckeln, zu kriechen und zu heucheln in ihr vermeintliches Bohème-Los auf. Die Frage ist nur, ob eine solche Einstellung zu besseren Leistungen beiträgt, ob sie nicht im „wissenschaftlichen Zeitalter“, in dem sogar am Theater privilegierte Cliquen von nüchternen Könnern abgelöst zu werden im Begriff sind, der Sache schadet.
Wir kommen zu dem Schluß, dass die Theater falsch organisiert sind. Eine Gruppe von Leuten, die sich zusammengetan hat, um ein künstlerisches Werk zustande zu bringen, darf nicht aus mächtigen Bestimmern und machtlosen Ausführenden bestehen – auch dann nicht, wenn beide Parteien sich in ihren Positionen wohl und sicher fühlen. Es geht nicht um das persönliche Befinden beispielsweise der Schauspieler, sondern darum, dass das Theater seinen Anschluß an die Zeit gewinnt, dass es ein echt interessierte Publi//kum bekommt, dass es vom Museum zur Arena wird. Man möge hier nicht einwenden, es sein von weit hergeholt, zu behaupten, die Wurzel des Übels liege in einem System der Theaterbetriebe, das sich doch bewähre – es ist fraglich, ob es sich bewährt (siehe Ergebnis), und es muss auch dann überprüft werden, wenn die Beteiligten nicht darunter leiden. Es wäre besser, sie litten. Denn das derzeitige System unterdrückt originale Initiative – am stärksten im Schauspieler – , es ist zu nichts gut, als unproblematische Massenprodukte hervorzubringen, die ein ans Applaudieren gewöhntes Publikum stumpf konsumiert. Dass einzelne Theaterleute versuchen, sich über die verfassungsmäßigen Gegebenheiten hinwegzusetzen, um echte Teamarbeit aufzuziehen, genügt nicht. Der Teamgedanke, d.h. die kollektive Führung des Betriebes, müsste Voraussetzung für die Arbeit sein. Versuche, auf dem Boden der derzeitigen Verfassung so etwas wie ein Mitspracherecht für alle zu installieren, lenken nur von der Notwendigkeit ab, die Verfassung selbst zu ändern.
Rechtfertigung der Gegenthese – Erstens: Zur Situation des Schauspielers im Theater
Noch vor einer Generation, als der Schauspieler gesellschaftlich hochgeschätzt wurde wie heute der Filmstar, besaß er eine natürliche Machtposition und nutzte sie. Heute fügt sich die gründlich entglorifizierte Person des Schauspielers von vornherein der Konzeption des Regisseurs (der heute am Theater Star sein kann) und beschränkt ihre Mitwirkung an einer bundesdeutschen Bühnenproduktion im Einhalten gewisser Positionen, im nach rechts oder links Hinübergehen, im Platz nehmen, Aufstehen, laut und leiser Sprechen, usw. Der Dialog zwischen Schauspieler und Regisseur ist meist schon zu Beginn der Proben zu einem pflichtgemäßen Geplänkel geworden. Dem Darsteller ist es um Sympathie von Seiten seines direkten Vorgesetzten, des Regisseurs, zu tun. Er wirbt um ein Wohlwollen, das er nötig braucht: erstens, um die eine oder andere Intention in Bezug auf seine Rolle durchsetzen zu können (Einfluss auf die Konzeption hat er ohnehin kaum je), zweitens, weil ihm daran gelegen ist, erneut und vorteilhaft eingesetzt zu werden.
Da der Schauspieler also kein Recht auf Mitbestimmung hat und infolgedessen aktive, das Ganze aufbauende Mitarbeit nicht gewohnt ist, wird er in dem Bemühen, Anweisungen des Regisseurs zu gehorchen, oft genug gezwungen, seine eigenen Impulse zu verleugnen, den Ablauf von Geste und Atem zu unterbrechen und seine Echtheit zu korrumpieren. Ein Ton aber, er aus einer diktierten Geste, aus einer erzwungenen Position heraus kommt, kann nicht mehr organisch sein und müsste, käme er echt, brechen, der Schauspieler folglich, von dem man mit Recht verlangt, dass er akustisch zu verstehen sein, entwickelt die Untugend des sog. Bühnentons, einen glatten, oft harten, von künstlicher Dynamik bewegten Stimmklang, der den Text vermittelt, aber nicht mehr menschlicher Ausdruck ist. Hier sein angemerkt, dass die Schauspielschulen den Forderungen des Marktes vollständig angepasst sind. Nach kürzester Ausbildungszeit (die Ausbildung des Kulturträgers Schauspieler wird weniger sorgfältig betrieben als die eines Facharbeiters), in der die Schüler gerade eben lernen, ihre Individualität effektvoll zu maskieren, werfen die Institute genormte Wirkungsinstrumente auf den Markt, die „gefallen und sich problemlos einsetzen lassen“. Regieschulen gibt es in der BRD nicht.
Zweitens: Zum Verhältnis von Regisseur und Schauspieler
Aufgabe des Regisseurs ist es, nach der dramatischen Vorlage eine Konzeption zu erarbeiten und diese mit Hilfe vor allem der Schauspieler auf der Bühne zu realisieren.
Für die Realisierung braucht er reale Mittel, d.h. Schauspieler, die mit ihrer gesamten Existenz vorhanden und seinsatzbereit sind. Zur Realität des spielenden Menschen gehören auch sein Machttrieb, seine Imagination, seine rationale und emotionale Kritik. Da der Regisseur diese Kräfte auf Grund seiner überragenden Machtposition a priori unterdrückt, hat er kaum eine Chance, seiner Konzeption auf dem Wege der Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit des Schauspielers zur vollen Realität zu verhelfen. Selbst extrem einsichtige, vernünftige Regisseure (deren Kampf gegen die Unnatur der Schauspieler in Wahrheit also ein Kampf gegen die eigene Macht ist), erreichen nur selten etwas, weil sie, selbst wenn sie auf die tätige Ausübung der Macht verzichten, sie existentiell eben doch vertreten.
Zur Methode der Gruppe der Regisseure, die durch Fritz Kortner repräsentiert wird, muss hier gesagt werden, dass sie keine Lösung ist. Zwar hat Kortner es vermocht, seinen Schauspielern anstelle des Bühnentons kreatürliche Äußerungen zu entlocken, die Einheit des Werkes (nicht des dramatischen, sondern des aufgeführten) wieder herzustellen – aber eben auf autoritäre Weise. Es geht hier darum, klarzustellen, dass es nicht darauf ankommt, den Schauspieler zum Besten des Ergebnisses perfekt zu dressieren, sondern, darauf, ihn in eine Richtung zu lenken, in der seine Entwicklung durch die im Dialog gewonnene Einsicht in das jeweils bessere Argument zu natürlichem Ausdruck führen kann. Das bestehende System allerdings rechtfertigt Kortner: wenn der Regisseur existenziell Macht verkörpert und somit nicht die Möglichkeit hat, vollständig auf sie zu verzichten, scheint es fast richtiger zu sein, die Macht so total auszuüben, dass auf diesem Wege wenigstens kreatürliche Äußerungen auf bundesdeutschen Bühnen zustande kommen.
Drittens: Auswirkungen auf die Arbeit
Die Arbeit am Theater erstarrt in der Regel im Laufe der Proben zu einem mechanischen Geben und Ausführen von Anordnungen („...bitte nehmen Sie das Lachen etwas zurück, ... da noch nicht in die Kraft gehen, ... den Ausbruch etwas später“, usw.); Schauspieler und Regisseur sind gemeinsam bestrebt, die Sache möglichst so reibungslos auf der Bühne zu arrangieren, dass keiner den anderen abdeckt, aus dem Licht drängt oder unterbricht. Der Regisseur inszeniert die Wirkung, verlangt das Ergebnis. Der Schauspieler mit wesentlichen Hinweisen, die den Weg anstelle des Ziels betreffen müssten, nicht versehen, springt aus seiner neutralen Ausgangshaltung blank in die Endposition, er „spielt“ die Wirkung anstelle einer Aktion, die wirkt – unter eingebildeter emotionaler Rechtfertigung. Das Schlimme ist, dass diese Arbeitsweise der natürlichen Trägheit de Schauspielers entgegenkommt, und dass sie ihm kaum je als eine falsche Methode bewusst wird, weil sie seine Individualität nicht in Frage stellt, erweitert oder sprengt (was Voraussetzung für lebendigen Ausdruck wäre), sondern sie innerhalb eines Rahmens belässt, den er überschaut. Er ist es zufrieden, wenn er sicher mit bewährten Mitteln agieren kann.
Auch die phantasievollen und engagierten Regisseure nehmen den Schauspieler als geistigen Partner nicht an, benützen ihn bloß als mehr oder minder geeignetes Organ für ihre Pläne und besitzen kaum je die Fähigkeit, die Instinkte des Schauspielers als geistige Anregung zu verstehen und zu verwerten. Kritische Mitarbeit von Seiten des Schauspielers wird als etwas Regelwidriges von Seiten des Regisseurs zur Kenntnis genommen und nicht als ein Standpunkt innerhalb einer Diskussion gesehen, welche die gesamte Arbeit auf eine dialektische Basis verlegen könnte, von der aus überhaupt erst fruchtbar zu operieren wäre.
Von daher (abgesehen von den mangelhaften, bzw. nicht vorhandenen Ausbildungsstätten) ist es zu erklären, dass bei vielen Theaterpraktikern eine fundamentale Unkenntnis herrscht über die Technik des Theaterspielens. Man ist allenfalls imstande, die Wirkung zu beschreiben, redet vage über Lockerheit und Atem – von den Schwungprinzipien des Körpers aber, von der Gesetzmäßigkeit, nach der der physische und stimmliche Ausdruck von physischen Motiven und Willensimpulsen oder Reflexen abhängt, weiß kaum einer Genaues. Wie aber soll der Regisseur die schwierigen Zusammenhänge kennenlernen, wenn der Schauspieler unfähig ist, genau zu erklären, was er tut, vor allem, was mit ihm geschieht, bevor er etwas tut, und warum er das, was er tut, so und nicht anders tut – unfähig infolge mangelnder Bewusstheit und unfähig aus Furcht vor dem vorgesetzten Spielleiter. Kritische Einwände gegen die Methoden des Regisseurs werden nicht innerhalb eines Teams offen erörtert und somit für den Fortgang der Arbeit nutzbar gemacht, sondern in der Garderobe oder am Biertisch mit Emotionen durchsetzt und vergeudet. Daß Regisseure am liebsten mit sog. Naturtalenten arbeiten, d.h. mit Schauspielern, deren natürliche Harmonie lebendigen Ausdruck garantiert, ist verständlich und zugleich symptomatisch für das System. Es müsste sich bewähren, indem es widersprüchlichen Geistern Chancen böte, sich zu manifestieren – es entlarvt sich selbst, wo es die Unschuld ungebrochener Natur als künstlerisches Ergebnis verkauft.
Vorschläge für ein neues System
Es kann nicht darum gehen, einen Schritt zurück zu tun, die Subventionen abzuschaffen und das Theater wieder in die freie Marktwirtschaft zu integrieren, sondern im Gegenteil darum, dass das Theater seine privilegierte Stellung endlich nutzt und seine Struktur umwandelt.
Die Ensemble-Idee wird von allen Theaterleuten gepflegt – kaum einem aber gelingt es, ein echtes Ensemble aufzubauen. Denn ein echtes Ensemble ist nur denkbar, // wenn jedes Mitglied für das gesamte Institut gleichermaßen verantwortlich ist. Wir schlagen daher die Demokratisierung der bundesdeutschen Theater vor.
Für detaillierte Vorschläge sind hier nicht Raum und Gelegenheit; wir nennen deshalb nur einige wesentliche Gesichtspunkte:
- Das Theater müsste kollektiv geleitet werden.
- Das Ensemble (Schauspieler, Regisseure, Dramaturgen, Bühnen- und Kostümbildner, Assistenten) müsste
- regelmäßig zu Versammlungen zusammentreten und Beschlüsse fassen können,
- sich selbst eine Haus- und Arbeitsordnung schaffen,
- aus seiner Mitte die kollektive Leitung wählen und abwählen,
- bei Neueinstellungen und Entlassungen künstlerischer Mitglieder mitbestimmen,
- bei der Spielplangestaltung sowie bei der Rollenbesetzung mitbestimmen.
- Wichtig wäre es,
- den Trend zur kollektiven Regie zu fördern,
- die karikierenden Fachbezeichnungen abzuschaffen,
- Einheitsverträge einzuführen und die Gagen nach sozialen Gegebenheiten zu staffeln.
Erst mit dem Errichten einer solchen demokratischen Basis für die Theaterarbeit entstünde, was Herr Suter und viele andere vermissen: die Diskussion – und zwar zwischen Theater und Öffentlichkeit gerade so wie innerhalb des Theaters. Diskussion innerhalb des Theaters heißt hier nicht literarischer Disput, sondern bedeutet für den Schauspieler: ein Aufspüren der Impulse, die für ihn zur Tat und zum Wort führen, ein Prüfen aller Abläufe auf ihren organisch-logischen Zusammenhang, ein Kennen und Erörtern der natürlichen Schwungprinzipien des Körpers und des Atems, eine ständige Bereitschaft zur rationalen Durchleuchtung emotionaler Wallungen;
für den Regisseur: ein äußerst sensibles Eingehen auf Ausdrucksskizzen, die der Schauspieler liefert, die Bereitschaft, persönliche „emotionale“ Vorstellungen hinter die Möglichkeiten, die der Schauspieler mit der Kombination seiner Anlagen hat, zurückzustellen, ein absoluter Verzicht auf das Inszenieren von fertigen Aktionen (d.h. von Ergebnissen), eine unbedingte Bereitschaft zur Identifikation mit jeder einzelnen Bühnenfigur und zum Errichten echter Balance zwischen dem, was die Bühnenfigur vom Schauspieler fordert und dem, was der Schauspieler ihr geben kann.
So zu arbeiten ist nur möglich, wenn Schauspieler und Regisseure gezwungen sind, aufeinander einzugehen. Deshalb nennen wir diese Arbeitsweise Diskussion. Daß sie bisher nicht stattgefunden hat, ist weder Schuld allein der Regisseure, der Schauspieler, noch der Intendanten, sondern die des Systems.
Die Resignation des enttäuschten Nachwuchses, das neidische Schielen auf Theatersensationen im Ausland bringt nichts ein. Auch politisches Engagement, zu dem die jungen Dramatiker das Theater herausfordern, trägt nur scheinbar Leben auf die Bretter. Revolutionäre Stücke werden durch veraltete Arbeitsmethoden zwangsläufig zu Pflichtübungen entschärft. Denn das Theater kann nur das nach außen hin zur Wirkung bringen, was seiner inneren Wirklichkeit entspricht.